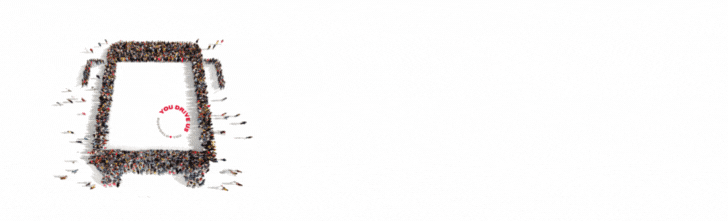Dabei mache es die Nachfrage in der aktuellen Hochsaison zum Teil schwierig, Bergführer überhaupt noch buchen zu können, räumt der Präsident des Salzburger Bergsportführerverbands, Wolfgang Russegger, ein. Dennoch sei der Wunsch nach Natur-Touren seit der Corona-Pandemie noch stärker als zuvor. Vermehrt werden auch ausgefalle Wünsche an Bergführer herangetragen. „Mancher möchte Gletscher sehen, ehe es sie nicht mehr gibt.“ Gerade Gletscher bergen allerdings – mit steigender Tendenz – sehr hohe Risiken, wenn es wärmer wird, denn dann bilden sich vermehrt die berühmten Gletscherspalten. Auch die Gewittergefahr und das Risiko für Starkregen seien gestiegen. Obendrein seien manche Wege zum Teil unbenutzbar geworden. „Viele haben weder das Wissen noch die Zeit, sich auf längere Touren gründlich vorzubereiten und die Gefahren zu erkennen“, so Russegger.
Risiken nicht unterschätzen
„Es gibt Touren, die wir früher problemlos begangen haben, dort sind heute Schutthalden mit Blöcken so groß wie Einfamilienhäuser“, sagt Bergführer Rolf Sägesser. „Früher waren sie mit Schnee oder Gletschereis überdeckt. Und es gibt Touren, die gehen praktisch gar nicht mehr. Das wären im Hochsommer Todesfallen.“ Manche hochalpinen Touren sollten nicht mehr im Juli oder August, sondern eher im Mai oder Juni stattfinden, wenn es noch kälter ist. Sägesser nennt die Eiger Nordwand, die er 1986 durchstieg: „Da war es ein Bruchteil so gefährlich wie heute.“ Damals vorhandene Eisfelder seien heute fast verschwunden. „Heute kann man die Tour praktisch nur noch in den Winter- bis Frühlingsmonaten unternehmen.“
Ein ebenso aktuelles wie spektakuläres Beispiel für die neue Risiko-Dimension wird der Bergsturz am Tiroler Fluchthorn angesehen. Im Juni war dort der gesamte Gipfel weggebrochen. Eine Million Kubikmeter Gesteinsmasse – das entspricht der Ladung von rund 120.000 Lastwagen – rauschten vom Berg herunter. Die Ursache wird im Auftauen des Permafrosts gesehen. Das Eis im Fels wirke wie Klebstoff, kommentierte der Tiroler Landesgeologe Thomas Figl und betonte, dass „der Klebstoff der Berge“ mit der Erwärmung langsam verloren gehe.
Nichtsdestotrotz scheint aber nicht nur der Klimawandel an Unglücken in den Bergen schuld zu sein. Neben ambitionierten und fähigen Kletterern kommen auch viele Unkundige in die Alpen. Einigen ginge es nur darum, Stoff für einen Post in den sozialen Netzwerken zu sammeln. Ein beliebtes Motiv, das dann sofort auf Instagram und Co. geteilt werde, sei zum Beispiel die spektakuläre Himmelsleiter am Donnerkogel. „Einige sind überrascht, dass sie dafür einen mehrstündigen Klettersteig bewältigen müssen“, sagt Russegger. Wer hier aber die körperlichen Voraussetzungen nicht erfüllt oder seine körperlichen Fähigkeiten aus Mangel an Erfahrung überschätzt, bringt sich auch ohne Klimawandel in Gefahr.
Auch Bergführer kennen den Fachkräftemangel
Viele Wander-Gruppen, die sich einen Bergführer leisten, buchen mehrtägige Touren. Der Tagessatz für einen Bergführer liegt in Österreich bei rund 540 Euro. Es empfiehlt sich, im Rahmen von Naturreisen langfristig zu planen und Bergführer weit im Vorfeld einer Reise zu buchen. Denn: Die Nachfrage nach versierten Führern trifft in den nächsten Jahren auf ein noch knapperes Angebot. Viele Bergführer scheiden aus Altersgründen aus dem Beruf aus, weiß Russegger. Nachwuchs zu finden, sei nicht einfach. „Gesucht wird der alpine Allrounder, der schon sehr gut klettern und Ski fahren kann, bevor er in die dreijährige Ausbildung geht.“ Nachwuchssportler könnten allerdings meist entweder nur das eine oder nur das andere. Frauen seien kaum unter den Bewerbern. Das Absenken der Hürden in Bezug auf Berufszugangsbeschränkungen sieht Russegger nicht als Option. Die Kunden müssten sich darauf verlassen können, dass ihr Bergführer bestens ausgebildet sei.