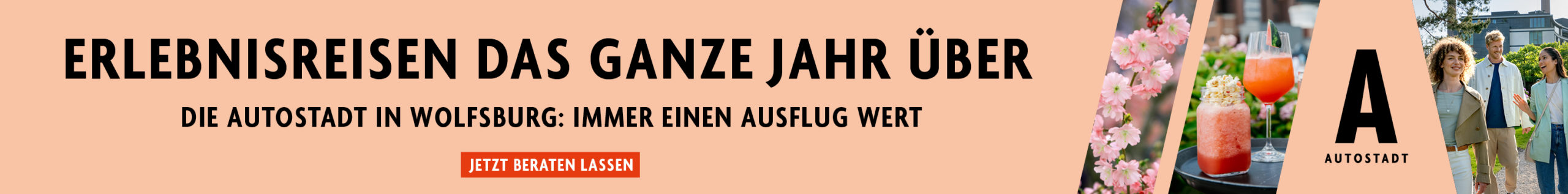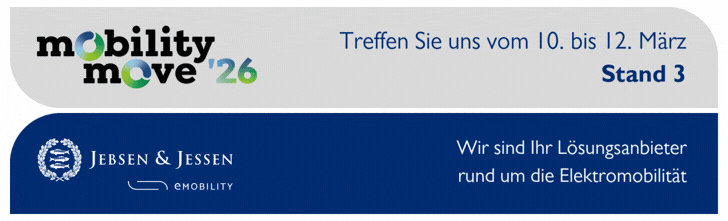Treffender hätte eine Geschichte über die Schweizer Pünktlichkeit wohl nicht beginnen können: Am 21. April fand in der Stadthalle Sindelfingen der 23. ÖPNV-Kongress des WBO statt. Allerdings, ein großer Teil der Referenten steckte zum offiziellen Beginn der Veranstaltung um 9.30 Uhr noch im Stuttgarter Verkehr fest. Was für ein von höherer Gewalt gelenktes Plädoyer für das Leitthema des Kongresses: der Finanzierung des ÖPNV. Nur der einzige internationale Referent des Kongresses, der junge Schweizer David Sorg, eigentlich als dritter Redner vorgesehen, saß bereits entspannt auf seinem Platz.
Das hatte natürlich einen Grund: Der 31-jährige Züricher war schon früher angereist, da er in Stuttgart noch gut vernetzt ist. Denn hier war bis vor Kurzem sein Arbeitsplatz. David Sorg war dreieinhalb Jahre bei der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) tätig, zuletzt als Assistent des Technischen Vorstands Wolfgang Arnold. Demzufolge hatte er Gelegenheit, sich mit dem ÖPNV in Stuttgart vertraut zu machen. „Ich finde es bemerkenswert, wie gut der öffentliche Nahverkehr in Stuttgart, trotz aller Unkenrufe, funktioniert. Da Stuttgart und Zürich von ihrer Größe und Verkehrsstruktur her sehr ähnlich sind, bin ich gespannt, inwieweit meine Erkenntnisse aus Stuttgart vielleicht auch in Zürich Anwendung finden können.“
Denkmodelle für besseren ÖPNV
David Sorg ist erst seit dem 1. März 2016 zurück in seiner Geburtsstadt und arbeitet dort bei den Verkehrsbetrieben Zürich an der strategischen Ausrichtung und Planung des ÖPNV. Wer schon mal in Zürich war, der weiß: die größte Stadt der Schweiz ist verkehrstechnisch kein einfaches Terrain. An einigen Verkehrsknotenpunkten ist zu Stoßzeiten gerne mal viel los. Straßenbahnen, Busse, Autos – tausende Verkehrsteilnehmer drücken sich auf engstem Raum durch die Stadt. Wer mit dem PKW unterwegs ist, muss viel Zeit einplanen und auch die öffentlichen Verkehrsmittel haben hier und da Probleme, da sie sehr voll sind und sich manchmal selber im Weg stehen. Zürich ist vergleichsweise eng, deshalb sind infrastrukturelle Maßnahmen, um einen besseren Verkehrsfluss zu gewährleisten, nicht so einfach umzusetzen, wie in einer etwas weiträumigeren Stadt.
Gefordert sind auf Nachhaltigkeit abzielende Denkmodelle, die nicht nur die Kosten im Zaum halten, sondern auch die Bedürfnisse der Bürger sowie die infrastrukturellen Gegebenheiten berücksichtigen. Zu diesem Thema hat sich David Sorg bereits in seiner Masterarbeit Gedanken gemacht. Vor seinem Einstieg bei der SSB studierte er das Studienfach „Raumentwicklung und Infrastruktur“ an der ETH Zürich.
Dabei widmete er sich der Fragestellung „Welches sind die Entscheidungskriterien in der Verkehrssystemwahl des städtischen Nahverkehrs?“ Nachdem die Abschlussarbeit publiziert wurde, erhielt David Sorg mehrere Anrufe von Verkehrsberatungsunternehmen und Fahrzeugherstellern, die sich für seine Arbeit und die darin enthaltenen Zahlen interessierten. „Dies hat mir gezeigt, wie dünn eigentlich die Zahlengrundlage in diesem Bereich ist und dass man Systementscheide nicht allein auf Kapazitätsgrenzen abstellen darf“, sagte David Sorg. Außerdem erhielt er den Prix LITRA, eine Auszeichnung des schweizerischen Informationsdienstes für den öffentlichen Verkehr, der damit die Forschung rund um den ÖPNV in der Schweiz fördert. Einige Teile aus der Abschlussarbeit waren auch Gegenstand seiner Präsentation beim WBO, allerdings trug sein Vortrag den etwas ketzerischen Titel „Ist der Bus die neue Straßenbahn?“
Eine Antwort auf diese Frage konnte David Sorg nicht geben, das wollte er aber auch gar nicht, im Gegenteil: Es geht ihm darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man bei Tram und Bus ähnlich denken muss, also die bestehenden Verkehrsmittel sinnvoll ergänzen sollte, anstatt einen „Verdrängungskampf“ zu betreiben. Sein Ziel ist es aufzuzeigen, wie der
ÖPNV der Zukunft gelingen kann. Der Ansatz konzentriert sich deshalb nicht nur auf ein Verkehrsmittel, sondern auf den gesamten ÖPNV. Zentral ist dabei die Frage: „Welche Verkehrssysteme müssen wir heute planen, um die Kundenbedürfnisse der Zukunft optimal abdecken zu können?“ Dabei müssen die naturgemäßen Vorteile der einzelnen Verkehrsmittel genutzt und in einer guten Qualität angeboten werden, sonst wird der ÖPNV durch die Konkurrenz aus selbstfahrenden Fahrzeugen, Uber und Co. bald ernsthafte Schwierigkeiten bekommen.
Qualität statt günstiger Preis
„Wenn es um eine große Fahrgastkapazität geht, wird die Schiene weiterhin Vorteile gegenüber dem Straßenverkehr haben“, erläuterte David Sorg. Gleichzeitig erfordere der Einsatz von Schienenfahrzeugen kostspielige Infrastrukturen, die nur bei hohen Fahrgastzahlen Sinn machen. „Der ÖPNV wird überall dort überleben, wo er gut ist“, sagt David Sorg. Und das gehe vor allem über Qualität und eben nicht, wie sich die Politik das manchmal ausdenkt, nur über einen günstigen Preis. „Gut heißt für die Kunden nicht automatisch billig. Von der Politik auferlegte Preissenkungen haben bisher kaum etwas gebracht.
Es ist vielmehr so: Wenn die Qualität leidet, fahren die Kunden nicht mit.“ Daraus resultiert für ihn: „Wenn der Bus gut sein soll, braucht er Geld, Platz und Priorität.“ Ein Verkehrsmittel, von dem man lernen könne, seien Bus Rapid Transit Systeme (BRT), mit denen David Sorg im Rahmen eines Praktikums in der peruanischen Hauptstadt Lima auch persönliche Erfahrung gesammelt hat. Auch in Frankreich (u.a. in Strasbourg) wurden BRT-Systeme gebaut, die zur Entschlackung des Innenstadtverkehrs beitragen. Elemente daraus, wie eigene Fahrwege, hochwertige Haltestellen und Fahrzeuge sowie attraktive Betriebskonzepte und einfache Ticketsysteme sollten auch in deutschen und schweizerischen Städten vermehrt übernommen werden, wofür natürlich eine ausreichende Finanzierung bereitstehen muss. Sein Fazit: Ob Schiene oder Bus, ÖPNV wird auch in Zukunft dort gut funktionieren, wo er dem Bedarf der Fahrgäste angepasst ist und eine gute Qualität bietet. (sb)